Landing on Water (1986)
Wenn andere 70er-Jahre-Größen, darunter Don Henley, mit modernen, synthielastigen Platten 80er-Jahre-Hits hatten, warum sollte Neil Young es dann nicht auch mal versuchen? Eine Frage, auf die die offensichtliche Antwort lautet: Weil es wie Landing on Water klingen könnte, auf dem perfekt gute Songs – nicht zuletzt Hippie Dream’s verheerendes Porträt von David Crosby in seiner verkoksten Ruine – durch eine sterile, unsympathische Produktion kaputt gemacht wurden.
Everybody’s Rockin‘ (1983)
Als monumentaler Mittelfinger gegenüber einer Plattenfirma, die von Young ein „Rock“-Album gefordert hatte, ist der Rockabilly- und 50er-Jahre-R&B von Everybody’s Rockin‘ ziemlich beeindruckend. Als Hörerlebnis, nicht so sehr. Die digitale Produktion ist schrecklich, das Cover von Jimmy Reeds Bright Lights Big City miserabel.
Old Ways (1985)
Es hat seine Momente, darunter My Boy und Are There Any More Real Cowboys? aber Youngs Country-Platte aus den 80er Jahren – die anscheinend wieder hauptsächlich produziert wurde, um sein damaliges Label Geffen zu ärgern – ist überproduziert, sirupartig und klischeehaft bis zu dem Punkt, an dem sie herablassend klingt. Sein späteres Umwerben des konservativen Nashville-Marktes durch reaktionäre Aussagen in Interviews wird am besten übersehen.
Are You Passionate? (2002)

Diese Kollaboration mit Booker T and the MGs, die durch das kriegerische, post-9/11-Thema Let’s Roll viel Aufmerksamkeit erregte, ist ansonsten vergesslich: kompetente, ziellose Mid-Tempo-Songs; wenig aufregend. Erleichterung stellt sich ein, als Crazy Horse bei Goin‘ Home anmutig in Erscheinung tritt.
Peace Trail (2016)
An Youngs aktueller Arbeitsmoral oder seinem politischen Engagement ist nichts auszusetzen, aber Peace Trail – sein zweites Album von 2016, das zum Teil von den Umweltprotesten im Standing Rock Reservat inspiriert wurde – war ein einziges Durcheinander: skizzenhaftes Songwriting, unausgegorene musikalische Ideen, darunter ein Ausbruch von Auto-Tuned-Gesang, platte Texte. Guter Titeltrack allerdings.
Life (1987)
Nachdem er Landing on Water mit einem unbeholfenen Einsatz von Synthesizern und Drumcomputern zum Scheitern gebracht hatte, ging Young dazu über, ein Album mit seinen alten Kumpels Crazy Horse auf genau dieselbe Weise zu verhunzen. Das ist ärgerlich, denn die Songs waren oft großartig, wie Prisoners of Rock and Roll beweist, ein virtuelles Manifest für Crazy Horse’s primitiven musikalischen Ansatz: „We don’t wanna be good.“
Fork in the Road (2009)
„I’m a big rock star, my sales have tanked / But I still got you – thanks“, bietet Young im Titeltrack an. Er ist ein ehrlicher Mensch, aber seine Verkaufszahlen hätten sich vielleicht besser gehalten, wenn seine späteren Alben nicht zunehmend abgehackt geklungen hätten, mit mehr Gedanken in ihren Botschaften – hier über Umweltverschmutzung und die anhaltende Finanzkrise – als in der Musik.
Broken Arrow (1996)
Es gibt eine weit verbreitete Theorie, dass Youngs Musik seit dem Tod seines langjährigen Produzenten David Briggs gelitten hat, dem einzigen Mann, der in der Lage zu sein schien, ihn zu zügeln und seine weniger inspirierten Ideen zurückzurufen. Sicherlich fühlte sich das erste Album, das er nach Briggs‘ Tod machte, ausufernd und richtungslos an: lange Crazy Horse-Jams neben Live-Tracks in Bootleg-Qualität.
Paradox (2018)
Darryl Hannahs inkohärenter Film über Young und seine letzten jungen Kollaborateure, Promise of the Real, ist ein Härtetest, der mit dem ähnlich ziellosen Dokumentarfilm Journey Through the Past von 1972 mithalten kann, aber der Soundtrack – ein Flickenteppich aus Instrumentalpassagen, Outtakes und Live-Aufnahmen – ist ziemlich eindringlich und unterhaltsam, während er dahintreibt, obwohl er eindeutig nur für eingefleischte Young-Fans geeignet ist.
Colorado (2019)
Das letzte in einer Reihe von mittelmäßigen Alben mit Crazy Horse, Colorado bietet einige aufrührerische Performances im patentierten ham-fisted Stil der Band – es gibt einen Moment in der Mitte von She Showed Me Love, in dem Schlagzeuger Ralph Molina scheinbar aus Versehen aufhört zu spielen – aber es bietet auch einige schmerzhaft auf der Nase liegende politische Texte, und nicht viel in der Art von anständigen Melodien.
Storytone (2014)

Die Unentschlossenheit plagte Storytone, das Young in drei Versionen veröffentlichte: eine orchestrierte, eine zurückgenommene und eine mit ein bisschen von beidem. Vielleicht erkannte er, dass das ursprüngliche Konzept des Albums, Neil Young als Crooner, nicht ganz funktionierte, da es zwischen charmant (das Big-Band-lastige I Want to Drive My Car) und schlockig (Tumbleweed) schwankte.
Prairie Wind (2005)
Das am wenigsten ansprechende von Youngs Harvest-Alben, Prairie Wind ist immer noch eines von Youngs stärkeren Alben der letzten Zeit. Die herbstliche, nachdenkliche Stimmung von He Was the King und This Old Guitar wurde vermutlich durch den Tod seines Vaters und Youngs eigene Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit nach einem Gehirn-Aneurysma beeinflusst.
Silver & Gold (2000)
Ein weiteres Album in der Country-Rock-Ader von Harvest. Die Höhepunkte sind hoch – der grüblerische Abschluss Without Rings ist besonders schön – aber es gibt eine Menge Füllmaterial, und die rosarote Nostalgie von Youngs Lobgesang auf seine frühere Band, Buffalo Springfield Again, ist besonders fadenscheinig.
Greendale (2003)
Von einigen als Rückkehr zur Form gefeiert – was einfach eine Verbesserung gegenüber dem glanzlosen Vorgänger Are You Passionate? – Greendale war Youngs Rockoper, ein grandioser Titel, der im Widerspruch zu seinem rauen, bluesigen Sound zu stehen schien. Das Songwriting ist zu uneinheitlich, um das Interesse aufrechtzuerhalten: Be the Rain und Bandit sind großartig, Grandpa’s Interview endlos.
Arc (1991)
Es war Thurston Moore von Sonic Youth, der Young vorschlug, ein Live-Album zu veröffentlichen, das ausschließlich aus den Feedback-geladenen Intros und Outros seiner Live-Auftritte besteht. Im Studio zu einem 35-minütigen Track gemischt, ist es nicht ganz so konfrontativ wie Lou Reeds Metal Machine Music, aber es lohnt sich, es zumindest einmal zu hören.
The Monsanto Years (2015)
Youngs letzte Begleitband, Promise of the Real, klingt hier feurig, und Young selbst ist hörbar wütend, aber The Monsanto Years war ein weiteres Album, das sich so übereilt anfühlte, dass das eigentliche Schreiben übersehen wurde. Die Texte – Feuer auf GVOs regnen lassend – fühlen sich oft mehr wie vertonte Blogposts als Songs an.
Trans (1982)
Inspiriert von seinem querschnittsgelähmten Sohn Ben, war ein elektronisches Neil Young Konzeptalbum mit vocodered vocals ein unglaublich mutiger Schritt, so sehr, dass Young es mit geradlinigerem Material auffüllte. Das Endergebnis war ein merkwürdiges Durcheinander; die Schönheit von Transformer Man kam erst voll zur Geltung, als Young es 1993 bei MTV Unplugged akustisch spielte.
Hawks & Doves (1980)
Abgelenkt durch familiäre Streitigkeiten war Youngs Nachfolger des Klassikers Rust Never Sleeps eine zerlumpte Sammlung zusammengewürfelter Country-Melodien und diverser Verschnittstücke. Hawks & Doves ist äußerst uneinheitlich, der Titeltrack ist schlichtweg schrecklich, aber die guten Stücke – das düstere Captain Kennedy, das schöne Lost in Space, The Old Homestead, eine lange Allegorie auf seine eigene Karriere – sind fantastisch.
Mirror Ball (1995)
Sichtlich stolz auf seine Bezeichnung als „Godfather of Grunge“ – Crazy Horse’s Kombination aus Lockerheit und Intensität war ein wichtiger Einfluss auf den Sound – arbeitete Young auf Mirror Ball mit Pearl Jam zusammen. Das Ergebnis war solide, aber nie explosiv oder kantig genug, um zu verhindern, dass man sich wünschte, er hätte mit seinen ehemaligen Tourkollegen Sonic Youth gearbeitet, die ihn vielleicht noch mehr gepusht hätten.
Chrome Dreams II (2007)
Klassischer Neil: 30 Jahre nachdem er es abgelehnt hat, ein Album namens Chrome Dreams zu veröffentlichen, bringt er einen Nachfolger heraus. Chrome Dreams II dreht sich um einen einzigen Track, das erstaunliche 18-minütige Ordinary People. Aufgenommen 1987, wirft es das meiste neuere Material des Albums in ein unversöhnliches Licht, aber das ausgefranste, ultra-verzerrte Dirty Old Man hält sich wacker.

Americana (2012)
Ein Album, das größtenteils aus dramatisch neu zusammengestellten Folksongs besteht – darunter Clementine und Oh Susanna -, ist Americana sporadisch großartig, gelegentlich schlampig und manchmal wirklich überraschend. Unwahrscheinlich genug, dass es mit Crazy Horse endet, die „God Save the Queen“ vertonen, wie die britische Nationalhymne, nicht das Lied der Sex Pistols.
Neil Young (1968)
„Overdub city“, protestierte Young über sein Solo-Debüt, und er hatte Recht. Es ist vollgepackt mit fantastischen Songs, zu denen Young live immer wieder zurückkehren würde – „The Loner“, „Here We Are in the Years“, „The Old Laughing Lady“ -, ächzt aber häufig unter der Last von Jack Nitzsches ausgefeilten Arrangements. Von da an setzte Young auf Einfachheit und Spontaneität.
Psychedelic Pill (2012)
Crazy Horse machten sich einen Namen mit ausgedehnten Jams, ein Ansatz, den Psychedelic Pill auf die Spitze treiben: der Opener „Driftin‘ Back“ dauert fast eine halbe Stunde. Ob es diese Länge rechtfertigt, ist eine andere Frage, obwohl Ramada Inn, das gerade mal 16 Minuten dauert, grandios ist.
Dead Man (1995)
Youngs erster Soundtrack zu einem Film, Journey Through the Past von 1972, war ein Mischmasch aus Live-Aufnahmen und Outtakes, der Fans, die ihn für den Nachfolger von Harvest hielten, in Schrecken versetzte. Live zu einem Rohschnitt von Jim Jarmuschs surrealem Western Dead Man gespielt, ist es etwas anderes: ein langes, kühles, gelegentlich gewalttätiges Gitarreninstrument.
American Stars ‚N Bars (1977)
Das schwächste von Youngs Studioalben der 1970er Jahre, American Stars ‚N Bars, vereinte Tracks vom damals unveröffentlichten Homegrown mit Lo-Fi-Heimaufnahmen (das seltsam gruselige Will to Love), bleiernen Country-Rock und einem unbestrittenen Crazy Horse Klassiker: Like a Hurricane (obwohl es bessere Live-Versionen gibt).
A Letter Home (2014)
Es klingt wie ein Novum – Young nimmt Coverversionen in einer Vinyl-Aufnahmekabine von 1947 auf, die Jack White gehört – aber A Letter Home funktioniert, springt von Songs, die Young als Kaffeehaus-Folksänger gespielt hätte, wie Bert Janschs Needle of Death, zu einer eindringlichen Version von Bruce Springsteens My Hometown.
Living With War (2006)
Schnell aufgenommen und veröffentlicht, unterstützt von einem 100-stimmigen Chor, klingt die Anti-Irak-Kriegs-Tirade Living With War nach Young, der von der Dringlichkeit seines Vorhabens und, so vermutet man, von dem Aufruhr, den es auslösen würde, angetrieben wurde. Eine anschließende Crosby Stills Nash & Young Tour, die dieses Material zum Inhalt hatte, wurde von den konservativeren Fans mit Buhrufen und Ausständen begrüßt.
Re-ac-tor (1981)
Ein Crazy-Horse-Album, das schleifend, düster und repetitiv ist (absichtlich so; es ist beeinflusst von einem zermürbenden Behandlungsprogramm, dem sich Youngs Sohn unterzog), Re-ac-tor ist harte Arbeit, gelegentlich uninspiriert und manchmal großartig, wie bei dem wilden Getöse von Surfer Joe und Moe the Sleaze und dem abschließenden Shots.
Harvest (1972)
Dass der riesige kommerzielle Erfolg von Harvest bei Young einen Anfall von eigensinnigem, sogar widerspenstigem Verhalten auslöste, war nicht so unerklärlich: Er wusste vermutlich, dass sein größtes Album bei weitem nicht sein bestes war. Die Songs schwanken zwischen fantastisch (der Titeltrack; Words) und vergesslich, während die Arrangements raffiniert, aber manchmal übertrieben sind, wie bei A Man Needs a Maid.
This Note’s for You (1988)
Bei weitem das erfolgreichste von Youngs Genre-Experimenten der 80er Jahre und eine Art kreative Wiedergeburt, ist Youngs bluesiges R&B-Album am besten für seinen Titelsong bekannt, eine Verunglimpfung der wachsenden Vorliebe des 80er Rocks für Firmensponsoring, aber seine besten Momente sind subtil und unaufdringlich: Das atmosphärische „Twilight“, die kleinstädtische Melancholie von „Coupe De Ville“.
Hitchhiker (1976)
Der Sound von Young allein im Studio, „den Wasserhahn aufdrehen“, wie David Briggs es ausdrückte, und neue Songs aus sich heraussprudeln lassen (von denen am Ende fast alle woanders neu aufgenommen wurden). Die Tatsache, dass Young hörbar heroisch bekifft ist, trägt nur zum intimen Charme des Albums bei.
Le Noise (2010)
Produziert von Daniel Lanois, ist dies Youngs bestes Album des 21. Lanois fügte die gelegentliche verwirrende Tonbandschleife hinzu, während Young sich selbst auf einer verzerrten E-Gitarre begleitet, die er eindeutig in ohrenbetäubender Lautstärke spielt. Diese frische Herangehensweise an ein Solo-Singer-Songwriter-Album führte zu starkem Material.
Harvest Moon (1992)
Harvest Moon ist besser als das klassische Album, auf das der Titel verweist und dessen Begleitmusiker es neu zusammenstellt. Der Sound passt zu den Songs, die wehmütig und von Nostalgie durchzogen sind. Der Titeltrack, dessen Riff von Walk Right Back der Everly Brothers geklaut wurde, ist eine wirklich schöne Hymne an die Ehe und die ewige Liebe.
Ragged Glory (1991)
Crazy Horse in ihrer fröhlichsten und primitivsten Form – Young nahm seinen Gesang offenbar in einem Haufen Pferdemist stehend auf – toben durch Garagen-Rock-Standards (Farmer John von den Premiers), krawallige Jams (Love and Only Love, Mansion on the Hill) und Lobgesänge auf ihre eigenen Grenzen (F!#*in‘ Up).
Homegrown (1975)
„Manchmal tut das Leben weh“, schrieb Young in der Erklärung für die verspätete Veröffentlichung von Homegrown im Jahr 2020, 45 Jahre nachdem er es im Zuge seiner Trennung von der Schauspielerin Carrie Snodgrass aufgenommen hatte. Es ist sicherlich niedergeschlagen, der Ton wird durch den Opener Separate Ways vorgegeben, aber es ist auch Young auf dem Höhepunkt seiner Kräfte, der zerbrechliche, schöne Songs schreibt.
Comes a Time (1978)
Das sanfte Country-Rock-Album, von dem sich seine Plattenfirma zweifellos wünschte, dass er es als Nachfolger von Harvest veröffentlicht hätte, Comes a Time ist weit besser als sein spiritueller Vorgänger. Es ist rauer – Crazy Horse tauchen auf dem wunderbaren Lotta Love und Look Out for My Love auf – und beherbergt zwei Young-Klassiker, darunter den Titelsong.
Freedom (1989)
Nach den verwirrenden 1980er Jahren kam Youngs atemberaubende Rückkehr zu voller, wütender Kraft genau zum richtigen Zeitpunkt und passte zu der aufkommenden Grunge-Bewegung, die er mit inspirierte. Das weithin fehlinterpretierte „Rockin‘ in the Free World“ war der Hit, aber „Freedom“ ist vollgepackt mit Killer-Tracks, vom langatmigen, mit Bläsern unterlegten „Crime in the City“ (Sixty to Zero) bis hin zu einer wilden, Feedback-gestützten Coverversion von „On Broadway“.
Sleeps With Angels (1994)
Kurt Cobains Abschiedsbrief zitierte einen Young-Text, sehr zum Entsetzen seines Autors; der Titelsong von Sleeps With Angels war seine verzweifelte Antwort. Der Titelsong Sleeve With Angels war die Antwort auf seine Verzweiflung. Ansonsten ist dieses Album genauso fesselnd und gruselig wie seine Werke aus der Mitte der 70er Jahre, mit Crazy Horse in überraschender Weise in gedämpfter Form. Piece of Crap stellt Young als schrulligen Verweigerer mittleren Alters vor, eine Rolle, die er noch oft spielen sollte.
Time Fades Away (1973)
Nur Neil Young würde seinem kommerziellen Durchbruch ein chaotisches Audio-Verité als Andenken an eine katastrophale Tour folgen lassen. Aber Time Fades Away ist nicht nur eine „Fick-dich-Geste“, es ist absolut überzeugend. Die Songs – das aufgewühlte Hippie-Getöse von Last Dance, die zerbrechliche Klavierballade The Bridge und das autobiografische Don’t Be Denied – sind unglaublich und werden durch die zerlumpte Performance noch verstärkt.
Zuma (1975)
Leichter im Ton als die „Graben-Trilogie“ (Time Fades Away, Tonight’s the Night und On the Beach), die ihr vorausging, brachte Zuma Young wieder mit einem wiederbelebten Crazy Horse zusammen und entfachte die glorreiche Beschwörung eines betrunkenen, mäandernden Geistes in Barstool Blues und das grüblerische, majestätische historische Epos Cortez the Killer. Und der züngelnde Schlusspunkt Through My Sails ist der letzte wirklich große Song, den Crosby Stills Nash & Young veröffentlichte.
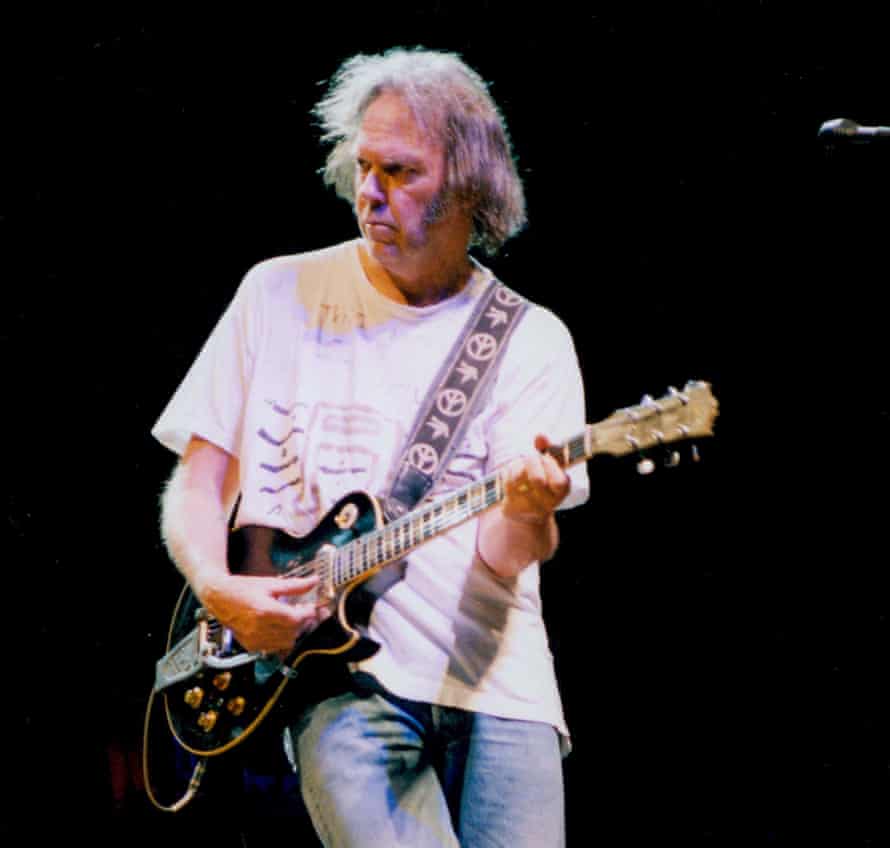
After the Gold Rush (1970)
After The Gold Rush fühlt sich an wie Youngs „Morgen-nach-den-60ern“-Album, aber im Gegensatz zum tröstlichen Ton von Simon & Garfunkels Bridge Over Troubled Water ist es hager, aufgewühlt und ergreifend. Zwischen den Beziehungsproblemen gibt es ökologische Katastrophen, Rassismus und Don’t Let It Bring You Down, das, wie Young anmerkte, „dich garantiert runterbringt“.
On the Beach (1974)
Verzweifelt und trostlos, aber mit wunderschöner Musik unterlegt: das schimmernde E-Piano von See the Sky About to Rain, das epische Akustik-Schlussstück Ambulance Blues („You’re all just pissing in the wind“, heißt es abschließend), die bekiffte, neblige Rockversion des Titelstücks. Als Kontrast dazu gibt es Revolution Blues, ein wildes, schonungsloses Porträt von Youngs altem Bekannten Charles Manson.
Tonight’s the Night (1975)
Youngs tequilageschwängerte, ungefilterte Reaktion auf den Tod des Crazy-Horse-Gitarristen Danny Whitten und ihres Roadies Bruce Berry ist ein erschütterndes, außerordentlich kraftvolles Hörerlebnis, bei dem die betrunkene Ausgelassenheit der Darbietungen zu den rohen Emotionen der Songs passt. Der Punkt, an dem Youngs Stimme während Mellow My Mind bricht, ist vielleicht der stärkste in seinem Katalog.
Everybody Knows This Is Nowhere (1969)
Youngs Debüt mit Crazy Horse ist ein unglaubliches Album: die schiere Kraft seiner Songs und seines Sounds; das Killer-Riff von Cinnamon Girl; die Art und Weise, wie das Spiel auf den ausgedehnten Jams Down By the River und Cowgirl in the Sand die lyrische Angst verkörpert und den Hörer selbst dann noch in seinen Bann zieht, wenn sie die 10-Minuten-Marke überschreiten.
Rust Never Sleeps (1979)
Die Grenze zwischen Youngs Live- und Studioalben war schon immer flexibel. Rust Never Sleeps wurde 1978 auf der Bühne aufgenommen und dann overdubbed. In Wahrheit könnte man die meisten seiner Alben aus den 70er Jahren als seine besten bezeichnen – er hielt einen bemerkenswert hohen Standard aufrecht – aber Rust Never Sleeps bietet eine perfekte Zusammenfassung all dessen, was ihn großartig macht, wobei seine Qualität vielleicht durch die Punk-Bewegung beflügelt wird, auf die er auf Hey Hey, My My (Into the Black) und, etwas elliptischer, auf Thrasher Bezug nimmt. Die Abfolge von Akustiksongs auf Seite eins ist atemberaubend, und Crazy Horse wüten in donnerndem Stil auf Seite zwei, wo Powderfinger eine herzzerreißende Saga über Gewalt, Tod und familiäre Bindungen enthält – wohl sein größter Song.