By Heart ist eine Serie, in der Autoren ihre absoluten Lieblingspassagen in der Literatur teilen und diskutieren. Lesen Sie Beiträge von Jonathan Franzen, Sherman Alexie, Andre Dubus III und mehr.
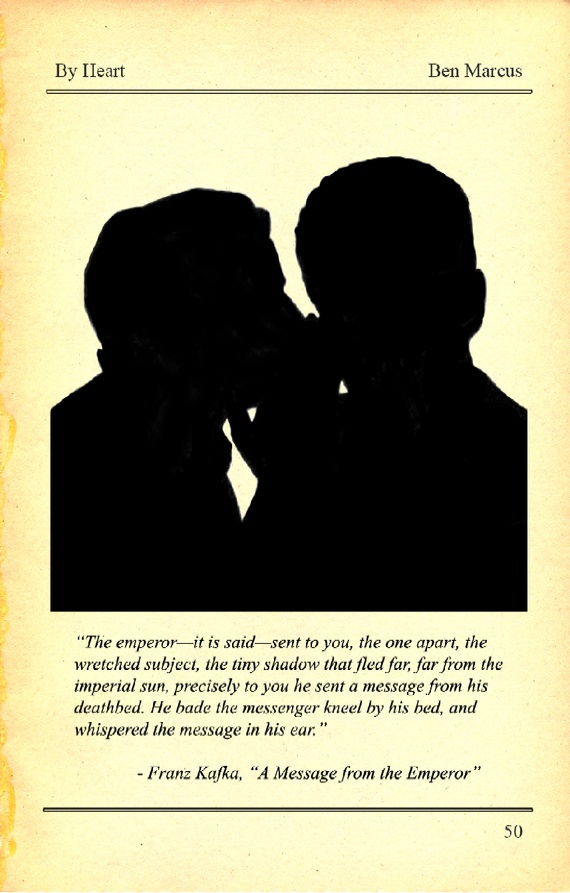
Schriftsteller, wenn sie uns tief berühren, werden zu Adjektiven. Die Visionen mancher Autoren sind so wiedererkennbar, dass sie als eine Art Kurzschrift dienen können: die „Proustsche“ Reminiszenz, der „Dickenssche“ Slum, das „Orwellsche“ Überwachungsprogramm. Das ist nützlich, vielleicht, aber nicht besonders präzise. Große Literatur neigt dazu, komplex zu sein und zur Debatte zu stehen, und vielleicht ist das der Grund, warum diese Wörter – anonyme Adjektive, wie sie technisch genannt werden – so leicht zu missbrauchen sind.
Siehe zum Beispiel das allgegenwärtige „kafkaesk“. Kafkas Name ist „in die Sprache eingegangen wie bei keinem anderen Schriftsteller“, sagte Frederick Karl, einer von Kafkas wichtigsten Biographen, 1991. (Das Wort ist sogar der Titel einer Folge von Breaking Bad.) Karl nannte das Wort „das repräsentative Adjektiv unserer Zeit“, beklagte sich aber auch über seinen Missbrauch: „Wovor ich mich hüte“, sagte er, „ist, dass jemand in einen Bus steigt und feststellt, dass alle Busse nicht mehr fahren, und sagt, das sei kafkaesk. Das ist es nicht.“
Mein Gespräch mit Ben Marcus war also erfrischend. Er wollte über „Eine Nachricht vom Kaiser“ sprechen, eine kurze Parabel, die 1919 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und für ihn ein entscheidendes literarisches Modell darstellt; seine Diskussion über das Stück beinhaltete schließlich ein prägnantes und brillantes Argument dafür, was das Kafkaeske ausmacht, obwohl er dieses Wort nie verwendete. Für Marcus sind die Quintessenz von Kafkas Qualitäten der berührende Gebrauch der Sprache, ein Schauplatz, der sich zwischen Fantasie und Realität bewegt, und ein Gefühl des Strebens selbst im Angesicht der Trostlosigkeit – hoffnungslos und voller Hoffnung.
Ben Marcus‘ neue Sammlung, Leaving the Sea, enthält 15 unterschiedliche Geschichten in einer Reihe von Modi. Marcus wurde als „experimenteller“ Schriftsteller eingestuft – zum Teil aufgrund eines viel gelesenen Essays in Harper’s, in dem er Jonathan Franzen niedermachte und seine „schwierige“ Arbeit lobte -, aber dieses Buch zeigt Marcus von seiner zugänglichsten Seite. Hier finden geradlinige (wenn auch beunruhigende) Erzählungen ihren Platz neben dichten verbalen Texturen, jedes Stück eine eigene Art von stark lyrischer Prosa. Marcus unterrichtet Belletristik am MFA-Programm für kreatives Schreiben der Columbia University. Er sprach mit mir per Telefon.
Mehr in dieser Serie
Eine Nachricht vom Kaiser
Der Kaiser – so heißt es – sandte dir, dem abseits Stehenden, dem unglücklichen Untertan, dem winzigen Schatten, der weit, weit vor der kaiserlichen Sonne floh, gerade dir eine Nachricht von seinem Totenbett. Er ließ den Boten an seinem Bett niederknien und flüsterte ihm die Nachricht ins Ohr. Er schätzte sie so sehr, dass er sie in sein Ohr wiederholen ließ. Mit einem Nicken des Kopfes bestätigte er die Richtigkeit der Worte des Boten. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes – alle hinderlichen Mauern sind niedergerissen und die großen Gestalten des Reiches stehen in einem Ring auf den breiten, hoch aufragenden Außentreppen – vor all diesen schickte er den Boten. Der Bote machte sich sofort auf den Weg; ein starker, ein unermüdlicher Mann; er stieß mal den einen, mal den anderen Arm vor und bahnte sich einen Weg durch die Menge; jedes Mal, wenn er auf Widerstand stieß, zeigte er auf seine Brust, die das Zeichen der Sonne trug; und er bewegte sich leicht voran, wie kein anderer. Aber die Menschenmenge ist so groß; ihre Behausungen kennen keine Grenzen. Wenn sich offenes Land vor ihm ausbreiten würde, wie würde er fliegen, und in der Tat könnten Sie bald das herrliche Klopfen seiner Fäuste an Ihrer Tür hören. Aber stattdessen, wie nutzlos müht er sich ab; noch immer zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und wenn ihm das gelänge, wäre nichts gewonnen: er müßte sich die Stufen hinunterkämpfen; und wenn ihm das gelänge, wäre nichts gewonnen: er müßte den Hof durchqueren und nach dem Hof den zweiten umschließenden äußeren Palast, und wieder Treppen und Höfe, und wieder einen Palast, und so weiter durch Jahrtausende hindurch; und wenn er endlich durch das äußerste Tor ausbräche – aber das kann nie, nie geschehen -, so läge vor ihm immer noch die königliche Hauptstadt, die Mitte der Welt, hoch aufgetürmt in ihrem Sediment. Hier kommt niemand durch, schon gar nicht mit einer Nachricht von einem, der tot ist. Du aber sitzt an deinem Fenster und träumst von der Botschaft, wenn der Abend kommt.
Auszug aus The Annotated Kafka, herausgegeben und übersetzt von Mark Harman, demnächst bei Harvard University Press. Verwendung mit Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. Diese Übersetzung, copyright © 2011 von Mark Harman, erschien zuerst im Blog der New York Review of Books, NYRblog (blogs.nybooks.com).
Ben Marcus: Ich glaube, ich habe Kafkas Parabeln zum ersten Mal in einem Philosophiekurs am College gelesen. Das war wahrscheinlich mein erster Kontakt mit Kafka. Gleichnisse sind ein starker Einstieg in diese Welt der Angst, Furcht und Paranoia, aber auch der Sehnsucht, Schönheit und Fremdheit, die ich mit Kafkas Werk verbinde. Die erste Parabel, die ich lese, ist „Leoparden im Tempel“ – es ist ein sehr kurzes Stück, schön und seltsam und unheimlich logisch. Später stieß ich auf „Eine Botschaft des Kaisers“, das zu meinem absoluten Lieblingsbuch wurde.
Es beginnt mit einer zwingenden These. Der Kaiser, die größte Figur der Zivilisation, schickt eine Botschaft an Sie. Diese Anfangskonfiguration ist fesselnd: Eine extrem wichtige Person hat Ihnen etwas mitzuteilen, und nur Ihnen.
Aber das Stück konzentriert sich auf die Unmöglichkeit, dass diese Botschaft jemals ankommt. Es stellt sich heraus, dass der Palast Ring um Ring um Ring von Mauern hat, aufeinanderfolgende Außenpaläste, und der Bote muss durch einen und dann durch den anderen und dann durch den anderen. Wenn er das jemals schaffen könnte – was er nie könnte, der Erzähler sagt uns, der Palast sei zu groß und unmöglich -, dann wäre er nur im Zentrum der Stadt, die voller Menschen und Müll ist, allerlei schwierige Hindernisse. Er wird nie durchkommen.
Das Ende ist eindringlich: Du wirst diese Botschaft, die nur für dich bestimmt ist, nie hören. Das bricht mir das Herz. Etwas Wichtiges wurde Ihnen mitgeteilt, aber Sie werden es nie hören. Und doch wirst du an deinem Fenster sitzen und es dir träumen – und so paart sich eine immense Sehnsucht und Hoffnung mit dem Gefühl der Unmöglichkeit und Vergeblichkeit. Diese unvereinbaren Empfindungen überfallen dich alle gleichzeitig. Das ist für mich einfach perfekt.
Es ist schwer zu übersehen, dass „A Message from the Emperor“ auf einer gewissen Ebene eine Parabel über das Lesen ist. Einerseits widerstrebt es mir zu sagen: „Hier geht es darum, was es bedeutet, eine Geschichte zu erzählen!“ – aber es scheint wirklich da zu sein. Ich sehe es gerne als eine Erinnerung daran, wie verzweifelt wir angesprochen werden wollen. Wir wollen angesprochen werden. Wir wollen, dass es da draußen eine wichtige Botschaft für uns gibt. Und doch: wie vergeblich es sein kann, darauf zu hoffen. Die Geschichte geht über eine bloße Veranschaulichung des literarischen Paradoxons hinaus: Sie deutet die höchste Schwierigkeit an, jemals wirklich mit jemandem in Verbindung zu treten. Bei Kafka hat man immer diese Art von düsterer Vergeblichkeit – aber die Vergeblichkeit fühlt sich nie flach und pessimistisch an. Trotz der Unmöglichkeit gibt es immer noch diesen Boten, der heldenhaft versucht, durchzubrechen. Die Parabel ist eine großartige Form, um dieses paradoxe Gefühl einzufangen.
Dieses Stück ist ein Modell dafür, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich lese. Und was ich möchte, dass andere fühlen, wenn sie lesen, was ich geschrieben habe. Was mich anzieht, ist die Art und Weise, wie es gegensätzliche, scheinbar widersprüchliche Empfindungen in Bewegung bringt und sie gegen alle Widerstände als vereinbar erscheinen lässt. Das Gefühl der Schwierigkeit, der Vergeblichkeit und des enormen Hindernisses – gepaart mit der Suche und dem sehnsüchtigen Verlangen und der Hoffnung.
Und das ist es, was das Schreiben für mich ausmacht – die Art und Weise, wie ich ein kurzes Stück lesen kann und mich innerhalb der kurzen Zeit, die ich brauche, um vom Anfang zum Ende zu kommen, verwandelt fühle. Es gibt bewusst zerebrale Texte, die ich auf ihre Weise fantastisch und schön finde – aber für mich muss Literatur am Ende etwas in mir auslösen. Und nicht nur ein bisschen. Ich möchte, dass das Schreiben die intensivste Form des Fühlens ist, die ich finden kann. Als ob wir Worte zusammensetzen, um unsere Gefühle tiefgreifend zu verändern oder zu verstärken oder auszulösen – um uns lebendiger zu fühlen. Das ist ein Teil dessen, warum ich eine Geschichte schreibe, warum ich Worte zusammensetze: weil sie letztlich ein ungeheurer – vielleicht sogar konkurrenzloser – Übertragungsmechanismus für intensive Gefühle sind. Die Art von Gefühl, mit der Kafka handelt, finde ich besonders reizvoll wegen ihrer Widersprüche und Konflikte, und wegen der Mischung aus Angst und Schönheit, der scheinbar unvereinbaren Empfindungen, die in der Schwebe gehalten und uns präsentiert werden.
Ohne nach dieser Art von Gefühl zu greifen, bin ich mir einfach nicht sicher, was ich tun würde. Das ist es, was ich in den kurzen Stücken in The Age of Wire and String versucht habe. Die Diktion und die Syntax und die Sprache, die ich benutzte, entstanden aus meinem Interesse daran, was ein einzelner Satz in unseren Köpfen und Herzen anrichten kann. Ein einzelner Satz kann durchdringend sein, fast wie eine Droge, wenn er bei mir ankommt. Ich lese, und während ich lese, fühle ich mich neu geordnet und transportiert und bewegt, als ob ich eine kleine Pille geschluckt hätte. Ich liebe Sätze, die sofort in meinen Blutkreislauf eindringen und mich aus dem Konzept bringen.
Ich denke, die emotionale Kraft von „A Message from the Emperor“ wird durch die Art und Weise unterstützt, wie es sich in einem unbestimmten Setting entfaltet. Die Welt, die beschrieben wird, ist nicht unsere eigene. Wir haben keinen Kaiser in einem Palast mit Ring über Ring über Ring von Plätzen, die jemand durchqueren muss. Kafka kippt weg von seiner eigenen Welt, hin zu etwas Altem und Mythischem. Gleichzeitig versetzt er uns mit dem Pronomen „du“ in die Geschichte. Er setzt uns an unsere eigenen Fenster und träumt von dem, was uns jemand Wichtiges, ein Gott, eine unbekannte Figur (die, wie er betont, jetzt tot ist, so lange hat es gedauert, bis die Nachricht ankam) sagen könnte.
Das ist ein verblüffendes Kunststück der Verfremdung – wir sind nicht in der realen Welt, und doch ist uns die Welt völlig vertraut – aus Geschichten, aus Mythen, aus Legenden. Sie ist traumhaft. Sie ist nicht in dem Maße erfunden, dass man den Glauben daran aufgeben muss – es gibt ein Gefühl der schlichten Normalität, dieser banalen Besonderheit, die unsere Welt ist, und gleichzeitig ist sie jenseitig. Ich habe diesen Effekt immer geliebt, weil ich sehr schnell anfange, Dinge in meinem eigenen Leben für selbstverständlich zu halten: Ich gehe die Straße entlang und denke nicht mehr daran, wie seltsam ein Baum sein kann. Ich höre auf, darüber nachzudenken, wie seltsam es ist, dass man auf der Oberfläche der Erde laufen kann, aber nicht von ihr herunterfällt. Oder wie seltsam es ist, dass wir all diese Dinge gebaut haben, um uns darin zu verstecken, genannt Häuser. Aber ich fange an, auf die Welt aufmerksam zu werden, erstaunt über die Tatsache, dass es sie gibt, wenn ich versuche, zu vergessen, was ich weiß. Wenn ich einen Weg finde, meine Annahmen abzustreifen, zu vergessen, was ich weiß, ist das ein Weg, sich in die Welt zurückfallen zu lassen, als hätte man sie noch nie gesehen. Es ist delirierend, es ist intensiv, es ist erschreckend, zu versuchen, die Welt neu zu sehen. Aber das ist ein literarischer Raum, den ich gerne erforsche.
Natürlich wollen die Menschen unterschiedliche Dinge, wenn sie lesen, und das respektiere ich. Es gibt einige, deren erster Wunsch es ist, die Bedeutung dessen, was sie gelesen haben, zu „verstehen“. Das ist ein völlig legitimer Wunsch. Aber vieles von dem, was ich liebe, liebe ich gerade deshalb, weil es sich dem Verständnis entzieht. Natürlich will man nicht nur Wortsalat lesen – einen Text, der einfach nichts bedeutet. Aber ich neige dazu, von Texten fasziniert zu sein, die nicht so leicht zu fassen sind, die widersprüchliche Lesarten aushalten und vielen Wiederholungen standhalten können. Wir können Literatur wie ein Produkt behandeln, das sich sofort und vollständig offenbaren soll – und das Tolle ist, dass wir das haben. Sie können in jede Buchhandlung gehen und das als das identifizieren, was Sie wollen, Sie können das bekommen. Es ist verfügbar. Aber es gibt auch rätselhaftere Sachen. Ich denke, es gibt Platz für alles.
Ein gutes aktuelles Beispiel ist der neueste Roman von J. M. Coetzee, The Childhood of Jesus. Ich habe einige seltsame und abweisende Kommentare über das Buch gesehen – viele Rezensenten waren nicht erfreut. Aber ich denke, es ist so fesselnd, so seltsam, so unwiderstehlich. Coetzee ist ein weiterer Schriftsteller, wie Kazuo Ishiguro, der einen in eine Art kafkanischen Raum mit unbestimmtem Kontext entführen kann: In diesem Fall kommt ein Mann mit einem Kind in einer Siedlung an. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keinen Kontext, man bekommt keine verdammte Rückblende – alle Erklärungen werden zurückgehalten. Das ist für manche Leser ein Dealbreaker. Und doch, für mich ist es die Abwesenheit dieser Dinge, die mich fesselt. Dadurch fühle ich mich hineingezogen und neugierig.
Neugierde ist eine interessante Sache. In den Kursen, die ich gebe, hört man häufig Folgendes: Wenn man über eine Geschichte spricht, wird jemand sagen: „Also, diese Figur John. Ich wollte mehr über ihn wissen.“ Das ist eine häufige Bitte – mehr Informationen über eine Figur zu erhalten. Aber nehmen wir mal an, Sie wissen alles, was es über diese Figur zu wissen gibt. Alle Daten, die Sie geben können: Geben wir die Rückblenden, zeigen wir die Kindheit. Würde das die Geschichte besser machen? Für mich ist das nicht so einfach. Man kann den Text mit Informationen überfluten, aber das steigert nicht das literarische Erlebnis, das Drama. Ich denke, es gibt einige Leser, die bereit sind, mit einem gewissen Maß an unbefriedigter Neugier zu leben – die Neugier treibt einen voran -, aber andere finden dieses Zurückhalten lästig. Sie wollen wissen, in Coetzees Fall, na ja, warte, ist der Junge Simon wirklich Jesus?
Interessant an diesem Roman ist vor allem, wie viel Arbeit der Titel macht. Denn nirgendwo im Buch wird explizit angedeutet, dass Simon als kleiner Junge Jesus sein soll. Aber die Tatsache, dass das Buch „Die Kindheit Jesu“ heißt, ist ständig präsent, ergreift einen und erinnert einen daran, dass man etwas liest, das sehr wahrscheinlich viel tiefer mit der Mythologie verbunden ist, als man vielleicht denkt. Das Buch hatte eine beunruhigende Wirkung auf mich. Ich bewundere, wie wenig Kontext Coetzee verwendet und wie fesselnd seine gegenwärtige Welt doch ist. Er nimmt einen mit in einen Moment, der so rigoros leer ist – und für mich ist das eine sehr Kafka-ähnliche Erfahrung.
Ich habe normalerweise nicht das Bedürfnis, auf irgendeine kritische Art und Weise zu wissen, worum es bei etwas „geht“, und ich würde viel lieber durch etwas Geheimnisvolles geführt werden. Aber wenn ich mich dabei ertappe, dass ich „sicher“ bin, dass es das ist, was ich gerne lese und was ich gerne tue, dann finde ich das schrecklich. Das ist genau der Zeitpunkt, an dem ich anfange zu denken, jetzt muss ich das alles einschalten. Ich muss sehen, was ich verpasse, wenn ich mich mit dieser Herangehensweise voll reinhänge. Ich korrigiere ständig den Kurs, basierend auf dem, was ich vorher geschrieben habe. Ich bin immer auf der Suche nach etwas, das ich noch nicht gemacht habe – und dadurch etwas zu erleben, das ich noch nie erlebt habe. Deshalb werde ich nervös, wenn ich anfange, so zu klingen, als würde ich eine einzige Vision davon propagieren, was Schreiben sein kann. Wenn ich seit einiger Zeit manierierte und seltsame Sätze schreibe oder lese, muss ich vielleicht ganz einfache Sätze ausprobieren, die sich im Verborgenen halten.
Denn die Mittel und Methoden der Literatur sind bis zu einem gewissen Grad unerkennbar. Wir wissen nicht, was passiert, wenn jemand ein Gedicht liest. Wir wissen, dass, selbst wenn ein Autor sich abmüht, einen präzisen Text zu verfassen, bei der Übertragung viel verloren geht – wir haben nicht einmal eine wirkliche Vorstellung davon, wie viel durchkommt. Das gibt mir enormen Respekt vor der Schwierigkeit und Vielfalt der Sprache. Schriftsteller glauben, wenn man die Wörter in eine bestimmte Reihenfolge bringt, wird man die Leser transportieren: Du wirst ihnen ein Gefühl geben, du wirst ihnen eine Empfindung geben, du wirst tiefe Dinge in ihrer Vorstellungskraft anregen. Und trotzdem können wir es nicht systematisieren. Wir können nicht sagen, ok, genau so schreibt man eine gute Kurzgeschichte. Genau so schreibt man einen Roman. Werke der Literatur müssen so sein und nicht so. Wir können über diese Dinge diskutieren, aber nur weil etwas einmal gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass man es wiederholen kann. Die Art und Weise, wie Bücher zusammenkommen, ist für mich unaussprechlich. Die Tatsache, dass ich so wenig über diesen Prozess weiß und mich dennoch so sehr zu ihm hingezogen fühle – nun, das ist es, was mich immer wieder zurückkommen lässt.
Wenn ich Kafkas Parabel lese, fühle ich Fremdheit und Schönheit, ich fühle Kummer. Es ist erfinderisch, und doch ist die Erfindung mit einem tiefen, eindringlichen Gefühl verbunden. Das sind für mich die wichtigen Werte: wenn etwas Jenseitiges einen emotional packt. Für mich ist das ein perfekter Text.